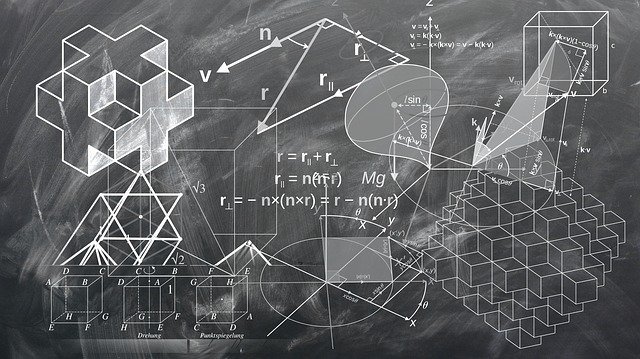Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.
Gründe
Die Verfassungsbeschwerde betrifft den Entzug von Teilen der elterlichen Sorge im Zusammenhang mit einer vor allem aus schulischer Überforderung resultierenden Kindeswohlgefährdung.
A.
I.
1. Die Beschwerdeführerin zu 1) ist die alleinsorgeberechtigte Mutter der 2005 geborenen Beschwerdeführerin zu 2), mit der sie im Bundesland Rheinland-Pfalz lebt.
a) Während der Grundschulzeit der Beschwerdeführerin zu 2) wurde im Dezember 2012 ein erstes Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs durchgeführt und dabei ein solcher im Förderschwerpunkt Lernen festgestellt. In diesem Rahmen durchgeführte Testungen ergaben im Culture Fair Intelligence Test einen IQ von 70 und im Hamburger Wechsler Intelligenztest für Kinder einen solchen von 74. Diese Befunde haben auch die Fachgerichte im Ausgangsverfahren zugrunde gelegt. Davon abweichende Ergebnisse scheinen sich aber in anderen Testverfahren ergeben zu haben. So hat im Ausgangsverfahren die dortige Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin zu 1) gestützt auf eine Epikrise einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie vom 2. April 2019 vorgetragen, es sei eine leichte intellektuelle Behinderung bei der Beschwerdeführerin zu 2) diagnostiziert worden. Im Hamburger Wechsler Intelligenztest für Kinder sei von der Fachärztin ein Wert von 65 ermittelt worden. Für das wahrnehmungsgebundene logische Denken habe sich ein im Bereich der leichten intellektuellen Behinderung liegender Wert von 63 ergeben. Auch die Werte für die Verarbeitungsgeschwindigkeit und des Raven-Matritzen-Tests wiesen eine solche leichte Behinderung aus. Zudem leide die Beschwerdeführerin zu 2) an einer Anpassungsstörung mit gemischter Störung von Gefühlen und Sozialverhalten. Ein zweites, im Jahr 2014 durchgeführtes Verfahren zur Feststellung eines Förderbedarfs ergab wiederum einen solchen Bedarf für die Beschwerdeführerin zu 2) im Förderschwerpunkt Lernen.
b) Nachdem die Beschwerdeführerin zu 2) die Grundschule beendet hatte, bestand die Beschwerdeführerin zu 1) gegen den Rat der Fachkräfte auf dem Verbleib in der Regelschule und auf einer inklusiven Beschulung. Sie meldete die Beschwerdeführerin zu 2) zunächst auf einem Gymnasium an. Dort kam es jedoch nach kurzer Zeit zu erheblichen Konflikten, aufgrund derer die Beschwerdeführerin zu 2) als Ordnungsmaßnahme wegen Übergriffen auf Mitschüler dauerhaft von dieser Schule ausgeschlossen wurde. Anschließend besuchte die Beschwerdeführerin zu 2) eine Realschule Plus, an der sie täglich drei Stunden beschult wurde. Auch hier traten erhebliche Konflikte zwischen der Beschwerdeführerin zu 2) einerseits und sowohl Lehrern als auch Mitschülern andererseits auf. Weitere Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs ergaben im Jahr 2018 einen solchen im Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung und im Bildungsgang Berufsreife sowie zuletzt im Förderschwerpunkt Lernen.
2. Das Jugendamt sah und sieht in dem Verbleib der Beschwerdeführerin zu 2) auf einer Regelschule bei unverändertem Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1) eine Kindeswohlgefährdung. Erstmals wandte es sich deswegen im Juni 2018 an das Familiengericht. In einem hier nicht gegenständlichen einstweiligen Anordnungsverfahren zum Sorgerecht gab das Familiengericht mit Beschluss vom 24. August 2018 der Beschwerdeführerin zu 1) unter anderem auf, an Gesprächen mit dem Jugendamt sowie an Fördermaßnahmen teilzunehmen, die Erreichbarkeit für das Jugendamt sicherzustellen, die Beschwerdeführerin zu 2) im Rahmen des Schulbesuchs zu unterstützen, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, Gespräche mit den Lehrern, der Schulleitung und der Schulbehörde wahrzunehmen, angeforderte Erklärungen zeitnah abzugeben, die Erreichbarkeit für die Schule, die Lehrer und die Schulbehörde sicherzustellen, an einem Clearing mitzuwirken und einen Antrag auf Bewilligung einer Integrationsfachkraft zu stellen. Die Beschwerdeführerin zu 1) hatte in diesem familiengerichtlichen Verfahren einem Wechsel der Beschwerdeführerin zu 2) von der Regelschule auf eine Förderschule sowie der Teilnahme an einer Tagesgruppe und einem ambulanten Clearing zugestimmt. Das Familiengericht hielt deshalb die genannten Auflagen gegenüber der Beschwerdeführerin zu 1) für erforderlich aber auch für ausreichend, um einer Gefährdung des Kindeswohls der Beschwerdeführerin zu 2) zu begegnen.
II.
1. In dem zugrundeliegenden Hauptsacheverfahren zum Sorgerecht berichtete das Jugendamt am 9. August 2019, dass aus seiner Sicht das Kindeswohl der Beschwerdeführerin zu 2) gefährdet sei. Sie sei pädagogisch nicht erreichbar und verhalte sich in der Schule hochauffällig. Zu der Beschwerdeführerin zu 1), die weiterhin nicht ausreichend mit den beteiligten Institutionen bei dem Bemühen zusammenarbeite, eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden, befinde sie sich in einer „quasi symbiotischen“ Beziehung.
2. a) Das Familiengericht bestellte der Beschwerdeführerin zu 2) eine Verfahrensbeiständin und führte zwei Termine durch, bei denen es auch die Beschwerdeführerin zu 2) mündlich anhörte. Darüber hinaus holte es zahlreiche Stellungnahmen unterschiedlicher beteiligter Fachkräfte ein, darunter Lehrkräfte und der Schulsozialarbeiter der von der Beschwerdeführerin zu 2) zeitweilig besuchten Realschule Plus. Die Verfahrensbeiständin sprach sich für einen Teilentzug des Sorgerechts für den Fall aus, dass die Beschwerdeführerin zu 1) den erforderlichen Wechsel der Beschwerdeführerin zu 2) auf eine Förderschule nicht mittrage. Auch die Erkenntnisse der Epikrise der Kinder- und Jugendpsychiaterin aus dem April 2019 hat das Familiengericht berücksichtigt.
b) Mit angegriffenem Beschluss vom 7. Januar 2020 entzog das Familiengericht der Beschwerdeführerin zu 1) das Recht zur Beantragung von Jugendhilfemaßnahmen, zur Stellung von Anträgen nach den Sozialgesetzbüchern, zur Regelung schulischer Belange sowie die Gesundheitssorge für die Beschwerdeführerin zu 2). Es ordnete Ergänzungspflegschaft des Jugendamts an und gab der Beschwerdeführerin zu 1) auf, transparent und konstruktiv mit dem Ergänzungspfleger zusammenzuarbeiten und diesen über wesentliche, das Kindeswohl betreffende Umstände ungefragt und zeitnah zu informieren.
Zur Begründung stützte es sich unter anderem auf die Einschätzung des Jugendamtes in dem Bericht vom 9. August 2019 über die fehlende pädagogische Erreichbarkeit der Beschwerdeführerin zu 2) und ihre quasi symbiotische Beziehung zu ihrer Mutter. Zwar sei die Beschwerdeführerin zu 1) bemüht, sich um das Wohl der Beschwerdeführerin zu 2) zu kümmern und sie zu fördern. Allerdings habe sich eine bereits seit längerem befürchtete Kindeswohlgefährdung konkretisiert. Die Beschwerdeführerin zu 1) erscheine nicht gewillt oder in der Lage, die Bedürfnisse der Beschwerdeführerin zu 2), die kognitiv eingeschränkt sei, zu erfassen und auf Basis der vorliegenden Diagnosen und Untersuchungsergebnisse sachgerechte Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu ergreifen. Eine Mitwirkung der Beschwerdeführerin zu 1) bei den Bemühungen der beteiligten Institutionen zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung sei nicht ausreichend gegeben.
Die Wahl der inklusiven Beschulung durch die Beschwerdeführerin zu 1) habe wegen der fehlenden Akzeptanz oder Umsetzung der festgestellten Diagnosen und des Förderbedarfs dazu geführt, dass die Beschwerdeführerin zu 2) nicht die erforderliche Förderung und Unterstützung erhalte. In dem vorangegangenen Verfahren habe das Jugendamt einen erheblichen Förderbedarf und erhebliche Defizite in der Entwicklung der Beschwerdeführerin zu 2) belegt. Es habe dargelegt, dass die Einsicht in die Notwendigkeit unterstützender Maßnahmen sowie die Mitarbeit der Beschwerdeführerin zu 1) fehlten und dass dies eine Gefährdung des Kindeswohls darstelle. Eine Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie beschreibe in ihrer Epikrise vom 2. April 2019 die Beschwerdeführerin zu 2) als unterdurchschnittlich begabt bis leicht intellektuell behindert. Sie befürworte eine Förderung durch eine Eingliederungshilfe. Aufgrund dieser Probleme hätten die Fachkräfte die Fortsetzung der Förderung in der Tagesgruppe nicht mehr für möglich gehalten, weshalb diese beendet worden sei.
Das Jugendamt habe berichtet, dass die Beschwerdeführerin zu 1) nur vordergründig bei Hilfemaßnahmen mitwirke; auch ein Integrationshelfer könne wegen der fehlenden Mitarbeit der Beschwerdeführerin zu 1) die Situation nicht verbessern. Der Schulsozialarbeiter habe mitgeteilt, dass die Beschwerdeführerin zu 1) für ihn nicht erreichbar sei. Angebotene Unterstützungsmaßnahmen lehne sie als nicht erforderlich ab. Die Beschwerdeführerin zu 1) überfordere die Beschwerdeführerin zu 2) mit einem Leistungsanspruch, dem diese nicht gerecht werden könne. Die Lehrer hätten über längere Zeit eine schulische Überforderung, zu Tage tretend durch aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern, beobachtet. Die Schulleiterin der Realschule Plus meine, die Beschwerdeführerin zu 2) könne an dieser Schule nicht beschult werden, obwohl es sich um eine Schwerpunktschule handele. Die Beschwerdeführerin zu 2) sei ihrer Einschätzung nach von der Beschwerdeführerin zu 1) dazu angehalten worden, sich nicht helfen zu lassen. Die Beschwerdeführerin zu 1) wirke nicht ausreichend mit, sie verweigere die Anerkennung der Gutachten über den Förderbedarf und lehne sämtliche Förderlehrer ab. Auch ein Integrationshelfer könnte wenig helfen. Weitere Lehrer berichteten, das Problem sei, dass die Beschwerdeführerin zu 1) ihre Tochter in schulischen Belangen zwar unterstütze, aber sehr ehrgeizige Ziele verfolge, die die Beschwerdeführerin zu 2) nicht erreichen könne. Diese leide unter einem hohen Stressfaktor aufgrund der Erwartungen der Beschwerdeführerin zu 1). Dieser permanente Stress zeige sich in Aggressivität gegen Mitschüler und Lehrer. Zudem habe die Beschwerdeführerin zu 2) im Jahr 2018 Suizidgedanken geäußert, auf die die Beschwerdeführerin zu 1) nicht ausreichend reagiert habe.
Das Vertrauensverhältnis der Lehrer zur Beschwerdeführerin zu 1) sei gestört. Gespräche fänden nur noch unter Zeugen statt, weil die Beschwerdeführerin zu 1) Inhalte falsch wiedergebe und verdrehe. Sie widersetze sich allen Fördermaßnahmen. Die Beschwerdeführerin zu 1) habe auf dem Verbleib auf der Grundschule und später auf der inklusiven Beschulung bestanden, weshalb die Beschwerdeführerin zu 2) auf der Realschule Plus verblieben sei. Die Beschwerdeführerin zu 1) sei entgegen der Meinung der Schulleitung und der Lehrkräfte der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin zu 2) trotz der Lernschwierigkeiten durch intensives häusliches Üben in der Lage sei, die Regelschule erfolgreich abzuschließen. Aus behördlicher Sicht sei eine Kindeswohlgefährdung nicht auszuschließen; die Lehrkräfte berichteten von täglicher Überforderung des Kindes mit den daraus resultierenden Auffälligkeiten. Die Schulaufsichtsbehörde habe die Notwendigkeit der Differenzierung der Zielsetzungen und der Reduzierung von Inhalten in einem Förderplan zur Entlastung des Kindes im schulischen Bereich betont.
Die Mutter scheine nicht in der Lage, die Untersuchungsergebnisse anzuerkennen und die erforderlichen Entscheidungen zu treffen. Seit Jahren liefen ihre Entscheidungen den Einschätzungen der Fachkräfte zuwider und der Zustand der Beschwerdeführerin zu 2) habe sich nicht verbessert. Die angeordneten Maßnahmen seien daher erforderlich. Das gelte auch für die Gesundheitssorge, weil psychiatrische Abklärungen des Gesundheitszustands erforderlich seien. Die elterliche Sorge sei auch nicht auf den rechtlichen oder den leiblichen Vater zu übertragen. Dies widerspräche dem Kindeswohl.
3. a) Gegen diesen Beschluss hat die Beschwerdeführerin zu 1) Beschwerde eingelegt. Das Oberlandesgericht hat im Beschwerdeverfahren aktuelle Stellungnahmen der Lehrer der Beschwerdeführerin zu 2) und der Schulbehörde eingeholt. Von einer erneuten mündlichen Anhörung der Beteiligten hat es unter Verweis vor allem auf die beiden mündlichen Anhörungstermine vor dem Familiengericht abgesehen, weil dadurch keine weitergehenden Erkenntnisse zu erwarten seien. Auch die erneute Anhörung der Beschwerdeführerin zu 2) sei aus diesem Grund nicht geboten, zumal eine solche für sie mit zusätzlichem Stress verbunden sei, der in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Erkenntnisgewinn stehe.
b) Mit dem angegriffenen Beschluss vom 13. Mai 2020 wies das Oberlandesgericht die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1) zurück. Das Familiengericht habe zu Recht angenommen, dass das körperliche und seelische Wohl der Beschwerdeführerin zu 2) aufgrund eines Versagens der Beschwerdeführerin zu 1) nachhaltig gefährdet sei. Weniger eingriffsintensive Maßnahmen als der Teilentzug des Sorgerechts seien nicht geeignet, die Gefahr für das Kindeswohl abzuwenden.
aa) Die Beschwerdeführerin zu 1) übe trotz stetiger gegenteiliger Ratschläge aller Fachkräfte einen derart enormen Leistungsdruck auf die Beschwerdeführerin zu 2) aus, dass diese permanent überfordert, traurig, verzweifelt und ohne jegliche Lebenslust sei; sie habe auch bereits Suizidgedanken geäußert. Mitunter komme es auch zu körperlichen Übergriffen der Beschwerdeführerin zu 1) auf die Beschwerdeführerin zu 2). Die Beschwerdeführerin zu 1) überfordere die Beschwerdeführerin zu 2), indem sie diese durch stundenlanges abendliches Lernen unter Druck setze. Bei schlechten Noten äußere die Beschwerdeführerin zu 2) in der Schule Ängste vor der Beschwerdeführerin zu 1), etwa vor Schimpfen oder auch Schlägen. An der Lage der Beschwerdeführerin zu 2) habe sich gegenüber derjenigen, die während des im Jahr 2018 geführten einstweiligen Anordnungsverfahrens bestand, nichts geändert. Die Situation für die Beschwerdeführerin zu 2) sei seit ihrem Schulbeginn untragbar. Es habe sich keinerlei Verbesserung für sie ergeben. Vielmehr sei eine Verfestigung der dauernden Überforderung und ihrer Angst vor den Reaktionen der Beschwerdeführerin zu 1) eingetreten. Nach Einschätzung des Jugendamtes sei die Beschwerdeführerin zu 2) weiterhin auffällig und befinde sich in einer „quasi symbiotischen“ Beziehung zur Beschwerdeführerin zu 1). Deren Mitwirkung sei nach wie vor nicht in ausreichendem Maße gegeben. Die Verfahrensbeiständin habe sich für einen Wechsel auf die Förderschule und gegebenenfalls den Entzug entsprechender Teile der elterlichen Sorge ausgesprochen. Der Förderbedarf des Kindes könne in der Realschule Plus nicht erfüllt werden.
bb) Die Beschwerdeführerin zu 1) habe sich nach der langjährigen Erfahrung der beteiligten Fachkräfte nicht bereit oder in der Lage gezeigt, eigene Vorstellungen zu überdenken und andere als die eigene Sichtweise anzuerkennen. Bei Abschluss des Verfahrens ohne Entzug der elterlichen Sorge sei damit zu rechnen, dass sie wieder nach ihren eigenen Interessen verfahren werde. Lediglich unter dem Druck von Gerichtsverfahren sei sie bereit gewesen, Handlungen zum Wohl des Kindes umzusetzen. Die Beschwerdeführerin zu 1) zeige keinerlei Einsicht in den Förderbedarf des Kindes und in die Notwendigkeit ihrer Mitarbeit. Diese ende, sobald ihre Einschätzungen denen der Fachkräfte widersprächen. Im Beschwerdeverfahren erneut eingeholte Stellungnahmen der Lehrer und der Schulbehörde ergäben, dass diese eine Änderung im Verhalten der Beschwerdeführerin zu 2) und in ihrer Überforderung nicht erkennen könnten. Sie habe weiterhin Angst vor schlechten Noten und fehlerhaftem Verhalten wegen der Reaktionen der Beschwerdeführerin zu 1) durch Schimpfen und Schläge. Nach einer erneuten Stellungnahme der Schulaufsichtsbehörde bedürfe es eines zieldifferenten Bildungsangebots unter Berücksichtigung der Lernbeeinträchtigung. Dies und die Überforderung führe bei der Beschwerdeführerin zu 2) zu zahlreichen frustrierenden Erlebnissen im Schulalltag, die sich negativ auf ihr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auswirkten.
Trotz mehrfacher sozialpädagogischer Gutachten mit der Erkenntnis eines IQ von etwa 70 und der Einschätzung, dass die Beschwerdeführerin zu 2) in der Regelschule nicht gut aufgehoben sei, habe die Beschwerdeführerin zu 1) ihre Tochter an einem Gymnasium angemeldet. Damit habe die Beschwerdeführerin zu 1) eindeutig gezeigt, dass sie nicht ansatzweise in der Lage sei, die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen und entsprechend zu handeln. Zudem könne sie die Empfehlungen von Fachkräften nicht annehmen, reflektieren und umsetzen. Die Beschwerdeführerin zu 1) verliere bei der Geltendmachung des Rechts auf Inklusion aus dem Blick, dass die Beschwerdeführerin zu 2) in vielen Bereichen beeinträchtigt und der Förderbedarf nicht gedeckt sei. Sie könne den besonderen Förderbedarf nicht anerkennen und nach den Ratschlägen der Fachkräfte handeln. Stattdessen mache sie die Lehrer verantwortlich, die sie für nicht in der Lage halte, Inklusion zu leisten. Die Beschwerdeführerin zu 1) stelle ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse, dass die Beschwerdeführerin zu 2) Abitur machen und studieren solle, in den Vordergrund, ohne wahrzunehmen, dass die Beschwerdeführerin zu 2) darunter leide. Nach dem Scheitern auf dem Gymnasium habe die Beschwerdeführerin zu 1) die Beschwerdeführerin zu 2) auf der Realschule Plus angemeldet, ohne die Lernbehinderung zu erwähnen und so die Lehrer zu sensibilisieren. Es sei zu erneuten Auffälligkeiten gekommen, die zu einem vorübergehenden Schulausschluss geführt hätten. Sämtliche Lehrer würden eine Überforderung des Kindes aufgrund des Leistungsdrucks durch die Beschwerdeführerin zu 1) beschreiben sowie massive Ängste der Beschwerdeführerin zu 2) vor Verhaltensweisen und Reaktionen der Beschwerdeführerin zu 1). Die Beschwerdeführerin zu 2) wolle dann nicht nach Hause, weine, sei sehr verzweifelt und äußere sogar Suizidgedanken.
cc) Die symbiotische Beziehung der Beschwerdeführerinnen zeige sich, indemdie Beschwerdeführerin zu 2) die ablehnende Haltung zu Personen, welche die Beschwerdeführerin zu 1) kritisiert, übernehme. Auch im Hinblick auf die Befindlichkeit der Beschwerdeführerin zu 2) werde deutlich, dass die Beschwerdeführerin zu 1) die Bedürfnisse ihrer Tochter nicht zu erkennen vermöge. Die Beschwerdeführerin zu 1) beschreibe das Kind als fröhlich und lege mit ihm gerechnete Mathematikaufgaben vor. Letztere können nach Auskunft der Lehrer aber nicht von der Beschwerdeführerin zu 2) gelöst worden sein, weil sie beim Abfragen in der Schule zu keiner Zeit dazu in der Lage gewesen sei. Die Einschätzung der Beschwerdeführerin zu 2) als fröhliches Kind wird von den Lehrkräften durchgängig nicht geteilt. Zudem deckten sich die Einschätzungen der Beschwerdeführerin zu 1) und ihrer Tochter über die gewünschte Art der Beschulung nicht vollständig. Diese habe in ihrer Anhörung durch das Familiengericht angegeben, dass sie nicht von der Beschwerdeführerin zu 1) getrennt werden wolle, sich aber durchaus den Besuch einer anderen Schule und einen Integrationshelfer vorstellen könne, so dass die Entscheidung nicht gegen ihren Willen ergehe.
dd) Das Oberlandesgericht stützt die Notwendigkeit eines Teilentzugs des Sorgerechts und das Fehlen von zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung geeigneten aber weniger eingriffsintensiven Maßnahmen auch auf das Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1) seit dem Beschluss des Familiengerichts vom 24. August 2018 im einstweiligen Anordnungsverfahren zur elterlichen Sorge. Die dort erteilten Auflagen habe die Beschwerdeführerin zu 1) nicht oder nur vordergründig erfüllt. Ein Clearing habe nicht stattgefunden, weitere Maßnahmen seien zwar begonnen worden, aber mangels Mitwirkung der Beschwerdeführerin zu 1) ohne Erfolg gewesen. Lediglich durch den Druck des Verfahrens habe die Beschwerdeführerin zu 1) einen Antrag auf eine Integrationsfachkraft gestellt und die hierfür erforderliche Diagnostik vornehmen lassen. Aufgrund des Ergebnisses, dass die Beeinträchtigung dauerhaft sei, sei nicht mehr das Jugendamt, sondern die Sozialabteilung der Stadtverwaltung zuständig. Trotz mehrfachen Hinweises habe die Beschwerdeführerin zu 1) den Antrag nicht bei der Sozialabteilung gestellt, sondern sie bestehe auf einer Integrationsfachkraft nach Jugendhilferecht. Weniger einschneidende Maßnahmen seien daher nicht geeignet, die Gefahr abzuwehren. Die angebotenen Hilfestellungen habe die Beschwerdeführerin zu 1) allesamt abgelehnt oder abgebrochen.
III.
Mit ihrer Verfassungsbeschwerde machen die Beschwerdeführerinnen die Verletzung von Rechten aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG geltend. Ferner berufen sie sich auf Rechte aus Art. 2 Abs. 1 und aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG sowie auf das Recht der Beschwerdeführerin zu 2) aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG.
1. Der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sei eröffnet. Das Elternrecht werde bei Eltern von Kindern mit Behinderungen durch die objektive Wertentscheidung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG dergestalt verstärkt, dass ihnen eine tragende Rolle bei der Unterstützung ihrer Kinder zukomme. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG sei zudem zu berücksichtigen, weil die Beschwerdeführerinnen eine hiervon geschützte Gleichbehandlung und inklusive Beschulung für die Beschwerdeführerin zu 2) einforderten.
2. Die fachgerichtlichen Entscheidungen griffen in den so verstandenen Schutzbereich ein, weil der Beschwerdeführerin zu 1) die elterliche Sorge entzogen werde und spiegelbildlich der Beschwerdeführerin zu 2) das Recht auf elterliche Sorge durch ihre Mutter genommen werde. Mittelbar liege eine Verletzung des Benachteiligungsverbots aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG vor, indem durch den Sorgerechtsentzug eine benachteiligende Beschulung der Beschwerdeführerin zu 2) auf einer Förderschule ermöglicht werde.
3. Die Eingriffe seien verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Für den Sorgerechtsentzug gelte ein strenger verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab. Die angegriffenen Entscheidungen ließen zudem ein grundsätzliches Fehlverständnis der Grundrechte aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG erkennen.
a) Die Fachgerichte hätten die Eignung des Eingriffs nicht hinreichend geprüft. Es sei nicht anzunehmen, dass die erfolgte Entziehung des Rechts zur Regelung schulischer Angelegenheiten den von den Gerichten angenommenen, auf der Beschwerdeführerin zu 2) lastenden Leistungsdruck mindern würde. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass die Konflikte zwischen der Beschwerdeführerin zu 1) und dem Jugendamt weiter eskalierten, worunter die Beschwerdeführerin zu 2) dann zusätzlich litte.
b) Ebenso wenig sei die Erforderlichkeit des Eingriffs geprüft worden. Das Oberlandesgericht habe sich letztlich auf die Feststellung beschränkt, dass die Beschwerdeführerin zu 1) Hilfestellungen durch das Jugendamt abgelehnt oder abgebrochen habe und diese deshalb nicht zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung geeignet seien. Auf die angebliche Weigerung, Auflagen zu erfüllen, könne die Entziehung des Rechts der Regelung schulischer Angelegenheiten aber nicht gestützt werden. Es hätte geprüft werden müssen, ob die Beschränkung auf den Entzug des Rechts der Beantragung von Jugendhilfemaßnahmen und Stellung von Anträgen nach den Sozialgesetzbüchern als milderes Mittel ausgereicht hätte. Dadurch wäre das auf die Hilfen in der Schule bezogene Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1) mit „abgegolten“.
c) Die Angemessenheit des Eingriffs fehle ebenfalls. Die angegriffenen Entscheidungen verkennten bereits die verfassungsrechtliche Eingriffsschwelle. Diese erfordere eine nachhaltige Gefährdung des Kindeswohls. Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG gestatte kein staatliches Tätigwerden, um entgegen dem Elternwillen für eine bestmögliche Entwicklung des Kindes zu sorgen. Es sei die Norm, dass Eltern Leistungsdruck auf ihre Kinder ausübten. Dies allein könne einen Sorgerechtsentzug nicht rechtfertigen. Eine aus Sicht des Staates falsche Wahrnehmung des Elternteils dürfe nicht deshalb korrigiert werden, weil dessen Entscheidungen den Zustand des Kindes „nicht verbessert“ hätten. Die Entscheidung der Beschwerdeführerin zu 1) für eine inklusive Beschulung der Beschwerdeführerin zu 2) dürfe im Sorgerechtsverfahren nicht gegen den Elternteil gewendet werden. Eine solche Handhabung des Fachrechts verstoße gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, der im Lichte des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention – BRK) auszulegen sei. Außerdem würde kompetenzwidrig die Entscheidung des Landesgesetzgebers untergraben, diese Entscheidung vorbehaltlos den Eltern zu überlassen.
aa) Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG biete insoweit ergänzenden Grundrechtsschutz, der auch mittelbare Benachteiligungen Behinderter erfasse. Dies verkennten die Fachgerichte, die eine Kindeswohlgefährdung gerade damit begründeten, dass die Beschwerdeführerin zu 2) entgegen den Empfehlungen der Fachkräfte nicht auf einer Förderschule angemeldet worden sei. Darin liege eine Benachteiligung im Sinne eines Ausschlusses von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten durch die öffentliche Gewalt, der nicht durch eine auf die Behinderung bezogene Fördermaßnahme hinlänglich kompensiert sei. Eine rechtliche Benachteiligung Behinderter sei nur gerechtfertigt, wenn zwingende Gründe diese erforderten. Die in Rede stehende Maßnahme müsse unerlässlich sein, um behindertenbezogenen Besonderheiten Rechnung zu tragen.
bb) Zwar habe das Bundesverfassungsgericht die Verweisung einer erheblich körperlich beeinträchtigten Schülerin an eine Sonderschule für gerechtfertigt erachtet (vgl. BVerfGE 96, 288 ff.). Die vom Bundesverfassungsgericht angewandten Maßstäbe seien aber nicht mit denen der UN-Behindertenrechtskonvention und neueren Erkenntnissen vereinbar. Eine Benachteiligung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG sei vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn ein Kind wegen einer Behinderung an eine Förderschule überwiesen werde. Art. 24 Abs. 1 BRK verpflichte die Vertragsstaaten, ein inklusives Schulsystem zu gewährleisten und verbiete eine Aussortierung von Schülerinnen und Schülern in ein segregierendes Schulsystem. Ein Ausschluss eines Kindes mit Behinderung aus dem Regelschulsystem und die Überweisung an eine spezielle Einrichtung könne allenfalls noch in Ausnahmefällen aufgrund eines zwingenden Grundes als Teil der Schulaufsicht des Staates nach Art. 7 Abs. 1 GG als kollidierendem Verfassungsrecht gerechtfertigt werden. Ein Ressourcenvorbehalt komme nur bei einer aufgrund außergewöhnlicher Umstände unverhältnismäßigen Belastung in Betracht. Die Darlegungs- und Beweislast für eine solche unverhältnismäßige Belastung liege beim Staat. Dies hätten die Fachgerichte etwa mit Blick auf die Bereitstellung weiterer Förderangebote für die Beschwerdeführerin zu 2) an der Regelschule, zusätzliche therapeutische Einheiten oder eine Veränderung des pädagogischen Konzepts auf der Grundlage eines konkreten Förderplans nicht ansatzweise geprüft und damit die Bedeutung und die Tragweite von Art. 6 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verkannt.
cc) Durch den auf § 1666 BGB gestützten Sorgerechtsentzug würde die Entscheidung des Landesgesetzgebers in § 59 Abs. 4 SchulG Rheinland-Pfalz umgangen, die Auswahl zwischen dem Besuch einer inklusiven Schule und einer Förderschule vorbehaltlos den Eltern zu überlassen. Durch den Sorgerechtsentzug mit der Möglichkeit für den Ergänzungspfleger, über die Schulwahl zu entscheiden, würde diese gesetzgeberische Entscheidung, die schon aus Gründen der Gesetzgebungskompetenz beachtet werden müsse, in ihr Gegenteil verkehrt. Der vorliegende Fall sei repräsentativ für ein strukturelles Versagen des Systems. Das dürfe nicht dazu führen, das vorbehaltlose Wahlrecht der Eltern faktisch auszuhöhlen. In der Wahrnehmung des vorbehaltlosen Wahlrechts eine Kindeswohlgefährdung zu sehen, verkenne die Grundrechte der Beschwerdeführerinnen aus Art. 6 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG.
dd) Hinsichtlich der Entziehung der Gesundheitssorge fehle eine Abwägung durch die Fachgerichte vollständig. Belege dafür, dass sich die Beschwerdeführerin zu 1) Untersuchungen der Beschwerdeführerin zu 2) in der Vergangenheit widersetzt hätte, ließen die Begründungen ebenso vermissen wie Erwägungen zu der Frage, ob deswegen ein vollständiger Entzug der Gesundheitssorge gerechtfertigt sei.
d) Die Beschwerdeführerinnen machen zudem geltend, dass die Fachgerichte zum einen wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen und zum anderen keine ausreichenden Feststellungen zu einer konkreten Kindeswohlgefährdung getroffen hätten.
aa) So seien die Fachgerichte nicht der Frage nachgegangen, ob die vermeintliche Gefährdung des Kindeswohls andere Ursachen habe als das angebliche Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1). Etlichen Hinweisen darauf, dass die Schule der Verpflichtung zur Umsetzung des Rechts auf inklusive Bildung aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und Art. 24 BRK nicht nachgekommen sei, seien die Fachgerichte nicht nachgegangen. Sie hätten nicht geprüft, was dazu notwendig wäre, und wie der momentan problematische Zustand von dieser Seite her verbessert werden könnte. Zu den von Art. 2 und Art. 24 BRK verlangten angemessenen Vorkehrungen gehöre es insbesondere, Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen so auszubilden, dass Inklusion tatsächlich stattfinden und gelingen könne. Die Beschwerdeführerin zu 2) habe nur geringfügige Beeinträchtigungen. Es liege keine geistige, sondern eine seelische Behinderung vor. Wenn bereits bei diesen Beeinträchtigungen konstatiert werde, eine Beschulung im Regelschulsystem sei nicht möglich, werde das Schulsystem den bestehenden rechtlichen Anforderungen nicht ansatzweise gerecht. Die Beschwerdeführerin zu 1) habe die Verfehlungen der Schule auch im Einzelnen dargelegt. Dies hätten die Fachgerichte zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht ausreichend gewürdigt. Auch die Haltung des Jugendamts hätte Anlass zur sorgfältigen Überprüfung der Ursachen für die angenommene Gefährdung des Kindeswohls geben müssen. Statt diese Überprüfung vorzunehmen, hätten die Fachgerichte ohne Weiteres Behauptungen von Beteiligten übernommen, die aufgrund einer ausdrücklich eingeräumten eigenen Überforderung mit den schulischen Verhältnissen ein Interesse daran hätten, die Beschwerdeführerin zu 2) an einer Förderschule unterrichten zu lassen. Die angegriffenen Entscheidungen übernähmen einseitig und unkritisch die Argumente der Lehrkräfte und des Jugendamts und blendeten andere Gesichtspunkte aus. Dadurch vertieften sie die Ungleichbehandlung der Beschwerdeführerin zu 2) noch weiter und sanktionierten zugleich das Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1), weil sie den Entzug von Teilen der elterlichen Sorge damit begründeten, dass sie den Empfehlungen der Fachkräfte „auch dieses Mal wiederum“ nicht folge.
bb) Es mangele zudem an hinreichenden Feststellungen zu einer rechtlich erheblichen Gefährdung des Kindeswohls. Bei der hier vorliegenden Eingriffsintensität durch dauerhafte Entziehung wesentlicher Teile der elterlichen Sorge sei jedoch eine eigene Tatsachenprüfung und -bewertung des Bundesverfassungsgerichts angezeigt.
(1) Die Fachgerichte hätten eine solche Gefährdung nicht ohne Weiteres annehmen dürfen, sondern konkret feststellen müssen. Die Tatsachenermittlung erweise sich als defizitär. Die eingeholte Stellungnahme der Schulaufsichtsbehörde könne eine Kindeswohlgefährdung weder bestätigen noch ausschließen. Die Gerichte hätten die einseitigen Einschätzungen der Schule und des Jugendamts unkritisch übernommen, die eine Gefährdung durch die Beschwerdeführerin zu 2) weitgehend an substanzarme Vorwürfe knüpften, wie beispielsweise einen übermäßigen Leistungsdruck oder eine „quasi symbiotische“ Beziehung zu ihrer Mutter. Damit sei eine nachhaltige Kindeswohlgefährdung nicht belastbar festgestellt. Es bestehe eine innige, liebevolle Mutter-Kind-Beziehung, die als „quasi symbiotisch“ konnotiert werde. Selbst Umstände, die für eine intakte Mutter-Kind-Beziehung sprächen, etwa die Unterstützung bei Hausaufgaben oder eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung, würden herangezogen, um diese vermeintliche „quasi symbiotische“ Beziehung zu belegen.
(2) Soweit die Fachgerichte festgestellt hätten, dass die Beschwerdeführerin zu 1) vorgehaltene Angebote ablehne, fehle es an konkreten Feststellungen, welche Angebote vorgehalten und abgelehnt worden seien. Dies könne sich auch nicht auf sonderpädagogische Förderung beziehen, denn hierauf habe sie keinen Einfluss. Sie handele auch nicht nur in „besten Absichten“, sondern aus nachvollziehbaren, gut begründeten Erwägungen. Weder lehne sie Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Beschwerdeführerin zu 2) grundsätzlich ab noch sperre sie sich gegen die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Schwerpunkt „sozial-emotionale Entwicklung“ und in Mathematik. Damit sei die Grundlage für die Schule zur zielangemessenen Förderung und Unterstützung der Beschwerdeführerin zu 2) gegeben. Die Beschwerdeführerin zu 1) habe sich zwar gegen die Feststellung eines weiteren Förderbedarfs im Schwerpunkt Lernen („Lernbehinderung“) ausgesprochen. Dafür gebe es aber gute, wissenschaftlich belegte Gründe. Entsprechende Etikettierungen würden pädagogisch als problematisch angesehen und in Teilen der Inklusionsforschung abgelehnt; sie gingen mit Stigmatisierung und Abwertung der Kinder einher. Es habe auch keine Notwendigkeit für die Feststellung eines weiteren Förderbedarfs bestanden, weil nicht erkennbar sei, dass die notwendigen Unterstützungsleistungen nicht aufgrund des bereits festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfs geleistet werden könnten.
(3) Ebenso hätten die Fachgerichte keine eigenen Feststellungen ‒ etwa durch Einholung eines Gutachtens ‒ dazu getroffen, dass die Beschwerdeführerin zu 2) aufgrund des Leistungsdrucks der Beschwerdeführerin zu 1) „Verzweiflung, Traurigkeit und Suizidgedanken“ geäußert habe. Sie hätten sich insoweit lediglich auf eine allgemein gehaltene und kaum substantiierte Aussage einer Lehrkraft gestützt. Selbst in der persönlichen Anhörung der Beschwerdeführerin zu 2) sei sie mit keinem Wort nach ihrer Verzweiflung oder Suizidgedanken befragt worden.
(4) Die Beschwerdeführerin zu 1) habe auch nicht durch ihr Verhalten die Bewilligung eines Integrationshelfers verhindert. Vielmehr habe sie sich zu Recht an das Jugendamt gewandt. Bei Streit zwischen den Leistungsträgern über die Zuständigkeit sei der zuerst angegangene Leistungsträger zuständig. Es liege entgegen der Einschätzung des Jugendamts bei der Beschwerdeführerin zu 2) zwar keine geistige aber eine seelische Behinderung vor, die die Zuständigkeit des Jugendamts begründe und bei der Jugendhilfe nach dem SGB VIII zu bewilligen sei. Dass die Beschwerdeführerin zu 1) hierauf bestehe, habe gute Gründe, denn in diesem Fall seien die Hilfskräfte in der Regel besser ausgebildet und die Hilfe sei kostenfrei. Das Oberlandesgericht übernehme die Darstellung des Jugendamts und leite daraus einen Vorwurf an die Beschwerdeführerin zu 1) ab.
(5) Auch sei die Einstellung der Beschwerdeführerin zu 2) zum Schulbesuch nicht hinreichend festgestellt worden. Soweit sie angegeben habe, sich einen Schulwechsel vorstellen zu können, sei dies ersichtlich auf einen ‒ von der Beschwerdeführerin zu 1) schon länger in Aussicht genommenen ‒ möglichen Wechsel auf eine andere inklusive Regelschule gerichtet gewesen. Wenn sich beide Beschwerdeführerinnen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen eine Umschulung auf die Förderschule wehrten, liege die Annahme fern, die Beschwerdeführerin zu 2) habe sich mit der Förderschule einverstanden erklärt.
4. Zugleich mit ihren Rechten aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG seien beide Beschwerdeführerinnen in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie die Beschwerdeführerin zu 2) in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG verletzt.
5. Die Beschwerdeführerin zu 2) macht zudem eine Verletzung in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG geltend. Aus den vorgenannten Gründen liege ein Verstoß gegen das spezielle Anknüpfungsverbot der Behinderung vor. Die Beschwerdeführerin zu 2) werde wegen ihrer Behinderung benachteiligt. Eine Rechtfertigung hierfür liege nicht vor. Eine solche komme nur im Wege einer Abwägung mit kollidierendem Verfassungsrecht und auf der Grundlage einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung in Betracht. Eine solche hätten die angegriffenen Entscheidungen gerade nicht vorgenommen. Insbesondere ergebe sich aus ihnen keine Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit oder anderer verfassungsrechtlich geschützter Güter.
IV.
Mit Beschluss vom 16. Juli 2020 hat die Kammer einen mit der Verfassungsbeschwerde verbundenen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt.
Der Kammer lag eine Initiativstellungnahme des Deutschen Instituts für Menschenrechte vom 26. August 2021 zur Auslegung von Art. 24 BRK und dessen Berücksichtigung bei der Auslegung des Grundgesetzes vor.
B.
Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an. Diese hat weder grundsätzliche Bedeutung noch ist die Annahme zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten Rechte der Beschwerdeführerinnen angezeigt (§ 93a Abs. 2 BVerfGG). Ob die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) bereits wegen fehlender Verfahrensfähigkeit, nicht wirksamer Vertretung im verfassungsgerichtlichen Verfahren oder unterbliebener Erschöpfung des Rechtswegs erfolglos ist, bedarf keiner Entscheidung (I). Denn die Begründung der Verfassungsbeschwerde und die dazu vorgelegten Unterlagen lassen jedenfalls eine Verletzung der Beschwerdeführerinnen in Grundrechten nicht erkennen (II und III).
I.
1. Ob die Beschwerdeführerin zu 2) als über 14-jährige Minderjährige entsprechend § 60 FamFG die Verfassungsbeschwerde selbst erheben kann (vgl. BVerfGE 72, 122 <133>), braucht wegen der Erfolglosigkeit der Verfassungsbeschwerde aus anderen Gründen nicht entschieden zu werden. Auch die Wirksamkeit ihrer Vertretung im verfassungsgerichtlichen Verfahren durch ihre Mutter, die Beschwerdeführerin zu 1), bedarf keiner abschließenden Beurteilung. Diese hat zwar hilfsweise erklärt, die Verfassungsbeschwerde als gesetzliche Vertreterin der Beschwerdeführerin zu 2) zu erheben. Dazu ist sie als allein Sorgeberechtigte grundsätzlich berechtigt. Durch die angegriffenen Entscheidungen wurde ihr die Vertretungsmacht im verfassungsgerichtlichen Verfahren nicht entzogen. Allerdings kann ein Interessenwiderstreit, der einer Vertretung durch sie entgegenstehen würde (vgl. BVerfGE 72, 122 <133>; 79, 51 <58>; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 24. August 2020 – 1 BvR 1780/20 -, Rn. 12 und vom 12. Februar 2021 – 1 BvR 1780/20 -, Rn. 18 f.), nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
2. Zudem bestehen Bedenken, dass die Beschwerdeführerin zu 2) dem Gebot der Rechtswegerschöpfung (§ 90 Abs. 2 BVerfGG), das Ausdruck des im Verfassungsrecht (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 GG) verankerten Grundsatzes der Subsidiarität ist, genügt hat, weil sie im fachgerichtlichen Verfahren selbst keine Beschwerde eingelegt hatte. Allerdings könnte der Zweck dieses Grundsatzes, dass die geltend gemachte Beschwer durch die zuständigen Instanzen der Gerichte ordnungsgemäß vorgeprüft und ihr nach Möglichkeit abgeholfen wird (vgl. BVerfGE 51, 386 <395 f.> m.w.N.; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 15. Oktober 2020 – 1 BvR 2262/20 -, Rn. 4), vorliegend durch ihre Beteiligung am Verfahren über die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1) dennoch erfüllt sein. Denn das Oberlandesgericht hatte die Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung ohnehin von Amts wegen vollständig und unabhängig von den erhobenen Rügen zu prüfen (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Januar 2011 – XII ZB 240/10 -, Rn. 8; vgl. auch BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 31. März 2020 – 1 BvR 2392/19 -, Rn. 9 m.w.N.).
II.
1. Die gegen den Beschluss des Familiengerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde ist bereits deshalb erfolglos, weil die Beschwerdeführerinnen dadurch nicht mehr beschwert sind. Die Entscheidung ist prozessual durch den Beschluss des Oberlandesgerichts über die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1) überholt; eine isoliert verbleibende Grundrechtsverletzung ist weder vorgetragen noch ersichtlich (vgl. dazu BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 27. November 2020 – 1 BvR 836/20 -, Rn. 13 m.w.N.). Das Oberlandesgericht hat in Beschwerdeverfahren in Familiensachen die Sache in vollem Umfang zu prüfen und eine eigene Sachentscheidung zu treffen (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 31. März 2020 – 1 BvR 2392/19 -, Rn. 9 m.w.N.). Das ist vorliegend erfolgt.
2. Soweit die Beschwerdeführerinnen eine Verletzung ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geltend machen, genügt die Begründung von vornherein nicht den Anforderungen aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG. Die Beschwerdeführerinnen haben es versäumt, ihre Verfassungsbeschwerde anhand der hierfür vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe zu begründen (vgl. BVerfGE 130, 1 <21>; 149, 86 <108 f. Rn. 61>; 151, 67 <84 f. Rn. 49>).
III.
Im Übrigen bleibt die Verfassungsbeschwerde beider Beschwerdeführerinnen ohne Erfolg, weil ihre Begründung und die dazu vorgelegten Unterlagen eine Verletzung in Grundrechten durch den Beschluss des Oberlandesgerichts vom 13. Mai 2020 nicht erkennen lassen. Das gilt sowohl für das Elternrecht der Beschwerdeführerin zu 1) aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG (1) als auch für das Recht auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung der Beschwerdeführerin zu 2) aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG (2) ‒ jeweils in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG.
1. Eine Verletzung des Elternrechts (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) der Beschwerdeführerin zu 1) ist anhand der Begründung der Verfassungsbeschwerde und der von den Beschwerdeführerinnen vorgelegten Unterlagen nicht erkennbar.
a) aa) Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern das Recht auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehung des Kindes ist damit primär in die Verantwortung der Eltern gelegt. Diese können grundsätzlich frei von staatlichen Eingriffen nach eigenen Vorstellungen darüber entscheiden, wie sie die Pflege und Erziehung ihrer Kinder gestalten und damit ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen (vgl. BVerfGE 60, 79 <88>). Die primäre Entscheidungszuständigkeit der Eltern beruht auf der Erwägung, dass die Interessen des Kindes am besten von den Eltern wahrgenommen werden. Dabei wird sogar die Möglichkeit in Kauf genommen, dass das Kind durch einen Entschluss der Eltern Nachteile erleidet, die im Rahmen einer nach objektiven Maßstäben getroffenen Erziehungsentscheidung vielleicht vermieden werden könnten (vgl. BVerfGE 34, 165 <184>). In der Beziehung zum Kind muss aber das Kindeswohl die oberste Richtschnur der elterlichen Pflege und Erziehung sein (BVerfGE 60, 79 <88> m.w.N.). Der Schutz des Elternrechts erstreckt sich auf die wesentlichen Elemente des Sorgerechts (vgl. BVerfGE 84,168 <180>; 107, 150 <173>).
bb) Das Recht der Eltern auf freie Gestaltung ihrer Sorge für das Kind verdient aber dort keinen Schutz, wo sich Eltern ihrer Verantwortung gegenüber dem Kind entziehen und eine Vernachlässigung des Kindes droht (vgl. BVerfGE 24, 119 <143 f.>). Wenn Eltern in dieser Weise versagen, greift das Wächteramt des Staates nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG ein; der Staat ist nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet, die Pflege und Erziehung des Kindes sicherzustellen, denn das Kind als Grundrechtsträger hat Anspruch auf staatlichen Schutz vor verantwortungsloser Ausübung des Elternrechts (vgl. BVerfGE 24, 119 <144>; 133, 59 <74 Rn. 43>). Dabei bestimmen sich die Schutzmaßnahmen nach dem Ausmaß des elterlichen Versagens und danach, was im Interesse des Kindes geboten ist (vgl. BVerfGE 24, 119 <144 f.>; 60, 79 <91>; 103, 89 <107>). Jede zum Zwecke der Abwendung einer Kindeswohlgefährdung getroffene staatliche Maßnahme muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten (vgl. BVerfGE 76, 1 <50 f.> m.w.N.).
cc) Aus der grundrechtlichen Gewährleistung des Elternrechts wie auch aus der Verpflichtung des Staates, über dessen Ausübung im Interesse des Kindeswohls zu wachen, ergeben sich Folgerungen für das Prozessrecht und seine Handhabung in Sorgerechtsverfahren (vgl. BVerfGE 55, 171 <182>). Das Verfahren muss grundsätzlich geeignet sein, eine möglichst zuverlässige Grundlage für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung zu erlangen. Das gerichtliche Verfahren muss in seiner Ausgestaltung dem Gebot effektiven Grundrechtsschutzes entsprechen. Das bedeutet nicht nur, dass die Verfahrensgestaltung den Elternrechten Rechnung tragen muss, vielmehr steht auch das Verfahrensrecht unter dem Primat des Kindeswohls, dessen Schutz staatliche Eingriffe in das Elternrecht nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG erst legitimiert (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 13. Mai 2020 – 1 BvR 663/19 -, Rn. 7). Die Gerichte müssen daher ihr Verfahren so gestalten, dass sie möglichst zuverlässig die Grundlage einer am Kindeswohl orientierten Entscheidung erkennen können (vgl. BVerfGE 55, 171 <182>). Eine dem Elternrecht genügende Entscheidung kann nur aufgrund der Abwägung aller Umstände des Einzelfalls getroffen werden (vgl. BVerfGK 15, 509 <514> m.w.N.), bei der allerdings auch zu berücksichtigen ist, dass die Abwägung nicht an einer Sanktion des Fehlverhaltens eines Elternteils, sondern vorrangig am Kindeswohl zu orientieren ist (vgl. BVerfGK 15, 509 <514> m.w.N.).
dd) Grundsätzlich ist dabei die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und die Würdigung des Tatbestandes sowie die Auslegung und Anwendung verfassungsrechtlich unbedenklicher Regelungen im einzelnen Fall Angelegenheit der zuständigen Fachgerichte und der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht entzogen. Ihm obliegt lediglich die Kontrolle, ob die angegriffene Entscheidung Auslegungsfehler erkennen lässt, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung eines Grundrechts oder vom Umfang seines Schutzbereiches beruhen (vgl. BVerfGE 18, 85 <92 f.>; stRspr). Anderes gilt zwar, wenn ein Kind von seinen Eltern gegen deren Willen getrennt wird. Bei gerichtlichen Entscheidungen, die Eltern zum Zweck der Trennung des Kindes von den Eltern das Sorgerecht für ihr Kind entziehen, besteht wegen des sachlichen Gewichts der Beeinträchtigung der Grundrechte von Eltern und Kindern Anlass, über den grundsätzlichen Prüfungsumfang hinauszugehen (BVerfGE 136, 382 <391 Rn. 28> m.w.N.). Hier wurden Teile des Sorgerechts jedoch nicht zum Zweck der Trennung des Kindes von seiner Mutter entzogen. Auch dann lassen sich die Grenzen der Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht aber nicht starr und gleichbleibend ziehen. Sie hängen namentlich von der Intensität der Grundrechtsbeeinträchtigung ab (vgl. BVerfGE 72, 122 <138> m.w.N.; BVerfGK 15, 509 <516>; stRspr).
b) Nach dem zurückgenommenen verfassungsrechtlichen Maßstab für die Prüfung von Sorgerechtsentscheidungen ohne Trennung von Eltern und Kind lassen die Begründung der Verfassungsbeschwerde und die damit vorgelegten Unterlagen nicht erkennen, dass der teilweise Entzug des Sorgerechts der Beschwerdeführerin zu 1) den materiellen und verfahrensrechtlichen Anforderungen daran nicht gerecht wird.
aa) Die Würdigung des Oberlandesgerichts, dass aufgrund des von ihm festgestellten Sachverhalts die fachrechtlich erforderliche Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 1666 Abs. 1 BGB (vgl. hierzu BGHZ 213, 107 <111 ff. Rn. 13 ff., 27>; BGH, Beschluss vom 6. Februar 2019 – XII ZB 408/18 -, FamRZ 2019, 598 <600 f. Rn. 18 f.; 602 Rn. 33>) vorliegt, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
(1) Es leitet diese Kindeswohlgefährdung nicht aus vorhandenen Einschränkungen der Beschwerdeführerin zu 2) her. Vielmehr sieht das Oberlandesgericht die Ursachen dafür im Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1), die der Beschwerdeführerin zu 2) die benötigte Unterstützung und Förderung nicht zu teil werden lasse. Zudem setze die Beschwerdeführerin zu 1) ihre Tochter durch überhöhte Erwartungen von Leistungen, die diese nicht erbringen könne, unter einen permanenten Leistungsdruck, der eine dauernde Belastung des Kindes bewirke. Diese finde in aggressivem Verhalten der Beschwerdeführerin zu 2) in der Schule, Traurigkeit, Verzweiflung und fehlender Lebenslust bis hin zu Suizidgedanken ihren Ausdruck. Es liegt innerhalb der den Fachgerichten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zustehenden Wertung, das festgestellte Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1) als einen außergewöhnlichen und aus erzieherischen Gesichtspunkten nicht mehr angemessenen Leistungsdruck einzuordnen. Die Beschwerdeführerin zu 1) stelle Anforderungen an die Beschwerdeführerin zu 2), die diese permanent überforderten. Sie erwarte die Erbringung schulischer Leistungen, zu denen ihre Tochter auch mit Unterstützung nicht in der Lage sei. Trotzdem übe die Beschwerdeführerin zu 1) den Feststellungen nach abends stundenlang mit ihrer Tochter und reagiere auf schlechte Noten mit verbalen und auch körperlichen Übergriffen. Der aus diesen Umständen gezogene Schluss, dass durch die so entstandene Überforderung und die erhebliche emotionale Belastung das Wohl der Beschwerdeführerin zu 2), insbesondere ihre seelische Gesundheit, gefährdet ist, verkennt weder die Bedeutung des Elternrechts noch den Umfang seines Schutzbereichs.
(2) Die so begründete Annahme einer Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 1666 Abs. 1 BGB verletzt das Recht der Beschwerdeführerin zu 1) aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG selbst dann nicht, wenn bei der Bedeutung des Elternrechts und staatlichen Eingriffen ein möglicher individueller Anspruch der Beschwerdeführerin zu 2) auf eine inklusive Beschulung zu berücksichtigen wäre.
(a) Ob ein solcher Anspruch des Kindes nach Art. 24 BRK besteht (zum Meinungsstand Siehr/Wrase, RdJB 2/2014, S. 161 <172 f.> m.w.N.; Riedel/Arend, NVwZ 2010, S. 1346 <1347 f.> einerseits; Krajewski, JZ 2010, S. 120 <123 f.> m.w.N.; Faber/Roth, DVBl. 2010, S. 1193 <1196>; Poscher/Rux/Langer, Von der Integration zur Inklusion, 2008, S. 37 f. andererseits), bedarf keiner Entscheidung. Jedenfalls kann aus Art. 24 BRK nicht der Schluss gezogen werden, die Familiengerichte dürften bei einer Sorgerechtsentscheidung nach § 1666 BGB schwere Belastungen des Kindes mit Behinderung ungeachtet der Umstände des Einzelfalls dann nicht berücksichtigen, wenn diese Belastungen damit verbunden sind, wie die Eltern die elterliche Sorge in Schulangelegenheiten ihres Kindes ausüben und was sie von ihrem Kind und von der Schule im Rahmen inklusiver Beschulung verlangen. Weder gebietet das Völkerrecht ein derartiges Verständnis des Familienrechts noch wäre es so mit Verfassungsrecht vereinbar. Völkerrechtlich würde damit Art. 7 Abs. 2 BRK nicht hinreichend Rechnung getragen, der bestimmt, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig berücksichtigt werden muss (vgl. Krajewski, JZ 2010, S. 120 <123>;Faber/Roth, DVBl. 2010, S. 1193 <1198>; Poscher/Rux/Langer, Von der Integration zur Inklusion, 2008, S. 35 f.). Verfassungsrechtlich wäre eine an einer pauschalisierenden Interpretation von Art. 24 BRK orientierte Auslegung des einzelfallbezogen anzuwendenden § 1666 BGB mit dem Anspruch des Kindes auf Schutz durch den Staat aus Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG im Falle einer konkreten Gefährdung seiner Gesundheit oder Persönlichkeitsentwicklung (vgl. BVerfGE 24, 119 <144>; 60, 79 <88>; 72, 122 <134>; 107, 104 <117>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 3. Februar 2017 – 1 BvR 2569/16 -, Rn. 39 ff.; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 30. April 2018 – 1 BvR 393/18 -, Rn. 6) nicht vereinbar (zu den Grenzen völkerrechtsfreundlicher Auslegung des Grundgesetzes vgl. BVerfGE 151, 1 <27-29 Rn. 63-65>).
Dabei kommt es nicht darauf an, ob und inwieweit allein aufgrund der Besonderheiten der Behinderung eine die inklusive Beschulung ausschließende Kindeswohlgefährdung angenommen werden kann. Vorliegend resultiert nach der nicht zu beanstandenden Beurteilung des Oberlandesgerichts die Kindeswohlgefährdung gerade nicht vornehmlich aus den Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin zu 2), sondern wesentlich aus dem Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1). Sie bewirkt im Ergebnis, dass notwendige Unterstützungen und Förderungen der Beschwerdeführerin zu 2) und ein erforderlicher zieldifferenter Unterricht nicht erfolgen, so dass die Beschwerdeführerin zu 2) von der inklusiven Beschulung im Ergebnis nicht profitieren kann, weil diese unter den im Ausgangsverfahren festgestellten Umständen für sie eine dauernde Belastung darstellt.
(b) Der Verfassungsmäßigkeit der Entziehung von Teilen des Sorgerechts der Beschwerdeführerin zu 1) steht auch § 59 Abs. 1 SchulG Rheinland-Pfalz nicht entgegen. Diese Regelung dürfte fachrechtlich bereits nicht das von den Beschwerdeführerinnen angenommene ausschließliche Wahlrecht gerade der leiblichen oder rechtlichen Eltern zwischen Beschulung in der Regelschule oder der Sonderschule gewährleisten. Sie übersehen insoweit die Regelung des § 37 Abs. 2 SchulG Rheinland-Pfalz. Danach sind Eltern im Sinne des Gesetzes die jeweiligen Inhaber der elterlichen Sorge, so dass die Regelung einem Sorgerechtsentzug nicht entgegensteht. Das Wahlrecht steht vielmehr nun nach den schulrechtlichen Regelungen dem Ergänzungspfleger zu.
Im Übrigen begegnete eine landesrechtliche Regelung im Schulgesetz, die einen wegen Kindeswohlgefährdung erforderlichen Sorgerechtsentzug ausschlösse, aus Kompetenzgründen verfassungsrechtlichen Bedenken, nachdem der Bund diesen in §§ 1666, 1666a BGB umfassend in Wahrnehmung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für das bürgerliche Recht gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG geregelt hat (vgl. Art. 72 Abs. 1 GG).
bb) Das Verfahren des Oberlandesgerichts und die Ermittlung des Sachverhalts durch dieses sowie vorausgehend durch das Familiengericht sind auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen ebenfalls verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
(1) Der Sachverhalt wurde umfangreich durch Anhörungen der Beschwerdeführerinnen, des Jugendamts und der für die Beschwerdeführerin zu 2) bestellten Verfahrensbeiständin sowie durch ‒ teils mehrfaches ‒ Einholen von Stellungnahmen der Schulleitung, von Lehrern, des Schulsozialarbeiters sowie der Schulaufsichtsbehörde aufgeklärt. Eine unkritische Übernahme einseitiger Einschätzungen ist dabei nicht erkennbar. Vielmehr legt das Oberlandesgericht umfassend dar, dass die Feststellungen auf den in den Stellungnahmen des Personals der Schule und der fachlich Beteiligten übereinstimmend geäußerten Einschätzungen beruhen. Das beinhaltet die ausführliche Schilderung der von ihm, wie bereits zuvor vom Familiengericht, angenommenen Überforderung der Beschwerdeführerin zu 2) und der Folgen des Leistungsdrucks durch die Beschwerdeführerin zu 1) auch im Einzelnen, so dass es sich gerade nicht lediglich auf substanzarme Vorwürfe stützt.
(2) Soweit die Beschwerdeführerinnen die Feststellung einer „quasi symbio-tischen“ Beziehung zwischen ihnen rügen, weil dabei eine innige Mutter-Kind-Beziehung verkannt werde, legen sie verfassungsrechtlich relevante Fehler nicht hinreichend dar. Sie haben sich bereits nicht mit den hierfür von den Fachgerichten benannten Berichten auseinandergesetzt und diese auch nicht vorgelegt, obwohl § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG dies grundsätzlich erfordert.
(3) Auch die Rüge einer fehlerhaften Ermittlung des Kindeswillens kann durch die Kammer nicht überprüft werden. Die Beschwerdeführerinnen haben versäumt, die Vermerke über die Kindesanhörungen vorzulegen. Zudem fehlt es an Vortrag zu den diesbezüglichen Ermittlungen des Familiengerichts. Auf diese hat das Oberlandesgericht inhaltlich Bezug genommen und gerade deshalb ‒ gestützt auf § 68 Abs. 3 Satz 2 FamFG ‒ auf eine erneute Anhörung der Beschwerdeführerin zu 2) verzichtet.
(4) Die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin zu 1) die angebotenen Fördermaßnahmen in der Realschule Plus ablehnt, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Hierzu verfügt das Oberlandesgericht über eine belastbare Grundlage. Bereits aus der mit der Verfassungsbeschwerde vorgelegten Stellungnahme der Schulaufsichtsbehörde ergibt sich, dass insbesondere Angebote zur zieldifferenten Unterrichtung des Kindes und sämtliche sonderpädagogischen Angebote von der Beschwerdeführerin zu 1) abgelehnt wurden und dass eine Kooperation ihrerseits mit der Schule nicht erfolgte. Inhaltlich Gleiches ergibt sich auch aus den in den angegriffenen Entscheidungen referierten aber von den Beschwerdeführerinnen nicht vorgelegten Stellungnahmen mehrerer Lehrer und der Schulleitung. Schließlich bestätigen auch die Beschwerdeführerinnen in der Verfassungsbeschwerde, dass die Beschwerdeführerin zu 1) den zuletzt festgestellten Förderbedarf der Beschwerdeführerin zu 2) im Bereich „Lernen“ negiert. Der Einschätzung der Beschwerdeführerinnen, mit dem von ihr akzeptierten Förderbedarf „sozial-emotionale Entwicklung“ aus einem vorherigen Gutachten hätten alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden können, steht entgegen, dass auch als dieser Förderbedarf aktuell festgestellt war, keine Fördermaßnahmen für die Beschwerdeführerin zu 2) eingerichtet werden konnten. Vielmehr lehnte die Beschwerdeführerin zu 1) ‒ soweit den angegriffenen Entscheidungen und den im Verfassungsbeschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen entnehmbar ‒ trotz des von ihr akzeptierten Förderbedarfs die angebotene Förderung ab. Auch in diesem Zeitraum war nach den Feststellungen der Fachgerichte die gebotene Zusammenarbeit mit ihr aufgrund dieser Ablehnung nicht möglich.
cc) Auf der Grundlage des fachgerichtlich festgestellten Sachverhalts ist bei Anlegen des für nicht zur Trennung von Eltern und Kind führenden Sorgerechtsentscheidungen geltenden Prüfungsmaßstabs nicht ersichtlich, dass das Oberlandesgericht die Verhältnismäßigkeit des erfolgten Sorgerechtsentzugs unter Verkennung der Bedeutung des Elternrechts bejaht hat.
c) Es bedarf keiner Entscheidung, ob ‒ wie von den Beschwerdeführerinnen vertreten ‒ für den Eingriff in das Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) der Beschwerdeführerin zu 1) strengere als die vorstehend erörterten Anforderungen gelten, weil wegen der Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin zu 2) das Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG berücksichtigt werden müsste. Selbst dann wäre der Sorgerechtsentzug auf der Grundlage der im Verfassungsbeschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterliegen Eingriffe in das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG strengen Voraussetzungen, wenn durch die angegriffene Entscheidung eine Trennung des Kindes von den Eltern im Sinne von Art. 6 Abs. 3 GG erfolgt ist oder erfolgen soll. Dafür muss das elterliche Fehlverhalten ein solches Ausmaß erreicht haben, dass das Kind bei den Eltern in seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet wäre (vgl. BVerfGE 60, 79 <91>; 72, 122 <140>; 136, 382 <391 Rn. 28>) und diese Gefährdung lediglich durch eine Trennung von Eltern und Kind nicht aber mit weniger eingreifenden Maßnahmen abgewendet werden kann (vgl. BVerfGE 136, 283 <391 Rn. 28>). Mit diesen aus der Verhältnismäßigkeit folgenden hohen materiellen Voraussetzungen geht eine strengere Prüfung der fachgerichtlichen Entscheidung und des ihr vorausgegangenen Verfahrens einher als bei sonstigen Eingriffen in das Sorgerecht. In solchen Fällen erstreckt sich die verfassungsrechtliche Prüfung auch auf einzelne Auslegungsfehler sowie auf deutliche Fehler bei der Feststellung und Würdigung des Sachverhalts (vgl. BVerfGE 136, 382 <391 Rn. 28>). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es sich bei der Trennung der Kinder von ihren Eltern um den denkbar stärksten Eingriff in das Elternrecht handelt (vgl. BVerfGE 60, 79 <89>; 79, 51 <60>).
bb) Ohne mögliche Auswirkungen des Benachteiligungsverbots aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG weist der vorliegend erfolgte Entzug von Teilen des Sorgerechts kein mit der Trennung des Kindes von den Eltern vergleichbares Eingriffsgewicht auf. Das gemeinsame Zusammenleben der Beschwerdeführerinnen ist weiterhin gewährleistet. Die Erziehung der Beschwerdeführerin zu 2) liegt unverändert ganz überwiegend in den Händen der Beschwerdeführerin zu 1). Die staatliche Einflussnahme auf die Erziehung der Beschwerdeführerin zu 2) ist alleine auf die schulische Ausbildung und die Gesundheitsfürsorge bezogen.
cc) Ob das Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG das Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG dergestalt verstärkt, dass Sorgerechtsentziehungen, die insbesondere das Recht der Regelung der schulischen Angelegenheiten eines durch Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG geschützten Kindes betreffen, an strengeren Maßstäben zu prüfen wären, kann offenbleiben (1). Denn der Beschluss hielte, soweit dies nach der Begründung der Verfassungsbeschwerde und den dazu vorgelegten Unterlagen beurteilt werden kann, auch einer strengen verfassungsrechtlichen Prüfung stand (2).
(1) Eine die Anforderungen an den Eingriff in das Elternrecht erhöhende Wirkung mag nicht von vornherein ausgeschlossen sein, wenn die Sorgerechtsentscheidung ein vom Schutzbereich des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG erfasstes Kind betrifft. Allerdings resultierte die den Schutz des Elternrechts aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG möglicherweise verstärkende Wirkung dann nicht, zumindest nicht vorrangig aus der Intensität des Eingriffs in die elterliche Entscheidungszuständigkeit selbst, sondern aus der besonderen Schutzbedürftigkeit des behinderten Kindes im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG. Selbst bei einer die Bedeutung des Elternrechts stärkenden Wirkung wäre den sich daraus ergebenen erhöhten Anforderungen daher genüge getan, wenn der Sorgerechtsentzug das Benachteiligungsverbot nicht verletzte. So verhält es sich hier bei Beurteilung auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen. Ob dem Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG eine das Elternrecht verstärkende Wirkung zukommt, muss daher nicht entschieden werden.
(2) Soweit dies auf der Grundlage der im Verfassungsbeschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen beurteilt werden kann, hielte der Entzug von Teilen des Sorgerechts der Beschwerdeführerin zu 1) auch dann verfassungsrechtlicher Prüfung stand, wenn der Eingriff in ihr Elternrecht zusätzlich wegen der Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin zu 2) an Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG zu beurteilen wäre ((a)). Dafür kommt es nicht auf die in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Maßstäbe für die Prüfung der schulrechtlichen Zuweisung eines Kindes an eine (vormals) Sonderschule (vgl. BVerfGE 96, 288) an ((b)).
(a) Es kann dahinstehen, ob in dem Entzug von Teilen des Sorgerechts der Beschwerdeführerin zu 1) mittelbar eine Benachteiligung der Beschwerdeführerin zu 2) wegen einer Behinderung (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) liegt. Selbst wenn die teilweise Entziehung des Sorgerechts deshalb strengeren Anforderungen unterliegen sollte, könnte ein Verfassungsverstoß hier nicht festgestellt werden.
(aa) Wäre für die Beschwerdeführerin zu 2) eine Benachteiligung wegen einer Behinderung (vgl. zum Kriterium BVerfGE 128, 138 <156>; 151, 1 <24 Rn. 55>) zu bejahen, wäre diese rechtliche Schlechterstellung nach der Wertung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG lediglich zulässig, wenn zwingende Gründe eine solche rechtfertigen (vgl. BVerfGE 99, 341 <357>; 151, 1 <25 Rn. 57> m.w.N.). Die Rechtfertigung einer Benachteiligung entgegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG unterliegt damit einem strengen Maßstab (vgl. BVerfGE 151, 1 <25 Rn. 57> m.w.N.). Sie kommt nur im Wege einer Abwägung mit kollidierendem Verfassungsrecht (vgl. BVerfGE 114, 357 <364>; 151, 1 <26 Rn. 59>) und auf der Grundlage einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung in Betracht. Die Ungleichbehandlung muss insoweit zum Schutz eines anderen, mindestens gleichwertigen Verfassungsguts geeignet, erforderlich und angemessen sein (vgl. BVerfGE 151, 1 <26 Rn. 59> m.w.N.). Es ist jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen, dass diese Wertung den Schutz des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG in der hier zu beurteilenden Konstellation in der Weise verstärken kann, dass eine strenge verfassungsrechtliche Prüfung vorzunehmen ist. Auch einzelne Auslegungsfehler (vgl. BVerfGE 60, 79 <91>; 136, 382 <391>) sowie deutliche Fehler bei der Feststellung und Würdigung des Sachverhalts (vgl. BVerfGE 136, 382 <391>) könnten dann beachtlich sein.
(bb) Der Beschluss des Oberlandesgerichts hielte auch einer solchen strengen verfassungsrechtlichen Prüfung in verfahrensrechtlicher (α) und materiellrechtlicher (β) Hinsicht stand.
α) Die Annahme einer Kindeswohlgefährdung durch die Fachgerichte aufgrund des von ihnen festgestellten Sachverhalts lässt keine beachtlichen Auslegungsfehler erkennen. Die Fachgerichte haben die Ursachen der Kindeswohlgefährdung hinreichend aufgeklärt (Rn. 64 ff.). Insbesondere waren dafür keine weitergehenden Ermittlungen zu der Frage geboten, ob die Schule oder das Land Rheinland-Pfalz einer Verpflichtung zur Umsetzung eines Rechts auf inklusive Bildung aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und aus Art. 24 BRK durch Schaffung erforderlicher struktureller Rahmenbedingungen hinreichend nachgekommen ist. Denn nach der beanstandungsfreien Würdigung des Oberlandesgerichts liegen die Ursachen der Kindeswohlgefährdung vor allem in dem Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1). Dieses bewirkt letztlich, dass notwendige Unterstützungen und Förderungen der Beschwerdeführerin zu 2) und ein erforderlicher zieldifferenter Unterricht nicht erfolgen können. Die Beschwerdeführerin zu 2) kann im Ergebnis von der inklusiven Beschulung nicht profitieren, weil diese für sie nach den getroffenen Feststellungen angesichts des Verhaltens der Beschwerdeführerin zu 1) mit einer dauerhaften erheblichen Belastung verbunden ist.
Die von den Beschwerdeführerinnen geforderten Ermittlungen wären zur Klärung der Frage, wie einer Kindeswohlgefährdung begegnet werden konnte, nicht geeignet gewesen. Selbst wenn festgestellt würde, dass insoweit die von den Beschwerdeführerinnen gerügten strukturellen Mängel im Schulwesen, insbesondere eine unzureichende Ausbildung der Lehrer und personelle und sachliche Ausstattung der Schule, vorlägen, könnten diese in einem kinderschutzrechtlichen Verfahren nicht behoben werden. Es liegt bereits nicht in der Kompetenz der Familiengerichte, bestimmte schulische Angebote anzuordnen; diese könnten allenfalls über den Verwaltungsrechtsweg erreicht werden. Soweit ersichtlich hat die Beschwerdeführerin zu 1) aber weder bei der Schulverwaltung noch den Verwaltungsgerichten ein Verfahren zur Bereitstellung dieser von ihr geforderten Angebote eingeleitet. Sie benennt auch keine konkret in Betracht kommenden Maßnahmen. Im Übrigen wären erhebliche Organisationsveränderungen in der Schule und im Landeshaushalt erforderlich, die nicht in einer für die Beseitigung einer aktuell vorliegenden Kindeswohlgefährdung angemessenen Zeit erreicht werden könnten. Denn gerade die geforderte geänderte Ausbildung der Lehrer und die Bereitstellung besonders für die Durchführung inklusiven Unterrichts ausgebildeter Personen kann aufgrund der erforderlichen Freigabe von Haushaltsmitteln, der Schaffung rechtlicher Grundlagen, dem erforderlichen Verwaltungsaufwand und der notwendigen Dauer solcher Ausbildungen nicht kurz- oder mittelfristig erfolgen. Solche möglichen langfristigen Veränderungen könne in dem seiner Natur nach grundsätzlich eilbedürftigen Kindesschutzverfahren in der Regel nicht berücksichtigt werden. Die Beschwerdeführerin zu 2) bis zu einer Behebung eventueller struktureller Mängel weiterhin unter den aktuellen ‒ als kindeswohlgefährdend festgestellten ‒ Bedingungen zu beschulen, würde die dadurch bestehende Belastung für sie vertiefen statt ihr entgegenzuwirken.
Vorliegend waren die Fachgerichte daher lediglich gehalten, die aktuell möglichen oder in angemessener Zeit verfügbaren Angebote der Schule zu prüfen und zu klären, ob deren Inanspruchnahme zur Abwehr der Kindeswohlgefährdung möglich ist. Hierzu haben sie in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass die Beschwerdeführerin zu 1) sämtliche Förderangebote abgelehnt und die notwendige Zusammenarbeit nicht geleistet hat, so dass eine hinreichende Förderung an der Regelschule nicht möglich ist. Unterstützungsmaßnahmen, die dennoch erfolgversprechend ‒ ohne oder trotz Widerspruch der Beschwerdeführerin zu 1) ‒ in der Regelschule hätten eingesetzt und in angemessener Zeit hätten eingerichtet werden können, sind nicht ersichtlich. Insbesondere benennen auch die Beschwerdeführerinnen keine konkreten Maßnahmen, deren Inanspruchnahme die Fachgerichte zu Unrecht nicht in Betracht gezogen hätten.
β) Der erfolgte Entzug von Teilen des Sorgerechts würde auch strengeren materiellrechtlichen Anforderungen genügen.
Er findet seine verfassungsrechtliche Grundlage in dem Anspruch eines Kindes aus Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG auf Schutz des Staates (vgl. BVerfGE 60, 79 <88>; 107, 104 <117>) und dessen damit korrespondierender Schutzpflicht (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 12. Februar 2021 – 1 BvR 1780/20 -, Rn. 27 m.w.N.). Als Erfüllung des Schutzanspruchs erweist sich der Sorgerechtsentzug in seinem gesamten Umfang auch nach Maßgabe der erwogenen strengen Anforderungen als verhältnismäßig.
Der Eingriff ist nicht deshalb ungeeignet, weil der im Ausgangsverfahren festgestellte, von der Beschwerdeführerin zu 1) ausgehende Leistungsdruck sich nicht verändern würde und weil Konflikte zwischen ihr und dem Jugendamt so weiter eskalieren würden. Nach den hier zugrunde zu legenden Feststellungen hat der Leistungsdruck seine Ursache darin, dass die Beschwerdeführerin zu 1) auf einer Beschulung an der Regelschule bestand und dabei auch eine zieldifferente Beschulung ablehnte. Dadurch wurde die Beschwerdeführerin zu 2) offensichtlich vor Anforderungen gestellt, denen sie nicht gewachsen ist. Mit einem Wechsel zu einer Beschulung, die die Beschwerdeführerin zu 2) nicht überfordert und auf für sie erreichbare Ziele ausgerichtet ist, kann ein das Kindeswohl gefährdender Leistungsdruck von der Beschwerdeführerin zu 1) nicht mehr in der bisherigen Weise aufgebaut werden. Selbst bei weiterhin geringer oder fehlender Zusammenarbeit der Beschwerdeführerin zu 1) mit der Schule ist eine belastende Lernatmosphäre für die Beschwerdeführerin zu 2) jedenfalls in einer solchen Weise wie in der Regelschule nicht mehr zu erwarten. Die angeführten zusätzlichen Konflikte mit dem Jugendamt belasten die Beschwerdeführerin zu 2) nur insoweit, wie die Beschwerdeführerin zu 1) sie darin einbezieht, was für die Beschwerdeführerin zu 1) jedenfalls vermeidbar ist. Im Übrigen waren für die Fachgerichte nicht die Konflikte mit dem Jugendamt, sondern zwischen der Beschwerdeführerin zu 1) und der Schule maßgeblich. Diese dürften sich verringern, weil nunmehr die Entscheidungen in schulischen Angelegenheiten vom Ergänzungspfleger zu treffen sind.
Der Eingriff ist auch erforderlich. Insofern kommt insbesondere nicht in Betracht, allein den Entzug des Rechts zur Beantragung von Jugendhilfemaßnahmen und zur Stellung von Anträgen nach den Sozialgesetzbüchern als milderes, in gleicher Weise geeignetes Mittel anzusehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt, vor jedem Sorgerechtsentzug wegen Kindeswohlgefährdung zu prüfen, ob der Kindeswohlgefährdung nicht auf andere Weise, insbesondere durch helfende, auf Herstellung oder Wiederherstellung eines verantwortungsgerechten Verhaltens gerichtete Maßnahmen, begegnet werden kann (vgl. zur Trennung des Kindes von der Familie BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 3. Februar 2017 – 1 BvR 2569/16 -, Rn. 43). Im Fall des Entzugs des Rechts der Schulwahl für ein Kind erfordert dies die Prüfung, ob nicht weniger einschneidende Jugendhilfemaßnahmen, schulische Angebote oder andere Hilfen verfügbar sind, die eine Abwehr der festgestellten Kindeswohlgefährdung ermöglichen. Im Falle eines behinderten Kindes führt die Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG dazu, dass insbesondere auf Hilfen zur Integration oder Inklusion Behinderter zu achten ist.
Dem trägt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Rechnung. Insbesondere kommt nicht in Betracht, allein den Entzug des Rechts zur Beantragung von Jugendhilfemaßnahmen und zur Stellung von Anträgen nach den Sozialgesetzbüchern als milderes, in gleicher Weise geeignetes Mittel anzusehen. Eine „Abgeltung“ einzelnen Fehlverhaltens, wie von den Beschwerdeführerinnen vorgebracht, allein durch den Entzug der unmittelbar damit verbundenen Teile der elterlichen Sorge (hier: des Rechts zur Antragstellung bezüglich Jugendhilfe beziehungsweise nach den Sozialgesetzbüchern im Übrigen wegen der fehlenden Inanspruchnahme von Unterstützungsmaßnahmen) ist dabei nicht möglich. Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls sind gerade keine Sanktionen, um Fehler der Eltern „abzugelten“. Zur Prüfung der Erforderlichkeit einer Maßnahme ist vielmehr zu klären, ob die in Betracht kommenden milderen Maßnahmen die festgestellte Kindeswohlgefährdung in gleicher Weise abwehren können. Hier haben die Fachgerichte eine Kindeswohlgefährdung durch die Überforderung der Beschwerdeführerin zu 2) an der Regelschule festgestellt. Diese Überforderung wird dadurch, dass die Beschwerdeführerin zu 1) sogar die vorhandenen Hilfsangebote ‒ insbesondere einen zieldifferenten Unterricht ‒ ablehnt, verstärkt.
Eine Beschränkung der Maßnahmen auf den Entzug des Rechts zur Antragstellung nach den Sozialgesetzbüchern alleine würde diese Gefahr aber nicht in gleicher Weise beseitigen, wie der erfolgte Entzug des Rechts der Entscheidung in schulischen Angelegenheiten. Zum einen ist nicht klargestellt, welche Hilfsangebote im Einzelnen in Betracht kommen, die an der Regelschule in Anspruch genommen werden könnten. Es ist nicht ersichtlich, dass es sich insoweit alleine um Jugendhilfemaßnahmen handelt; im Gegenteil ist jedenfalls die Entscheidung über zielgleiche oder zieldifferente Beschulung ebenfalls eine Entscheidung aus dem Bereich der schulischen Angelegenheiten. Zum anderen haben die die Beschwerdeführerin zu 2) unterrichtenden Lehrer mehrfach ausgeführt, dass gerade die notwendige Kooperation der Beschwerdeführerin zu 1) fehlt. Diese Kooperation wäre aber ersichtlich für eine erfolgreiche Unterstützung an der Regelschule erforderlich. Dass die Beschwerdeführerin zu 1) die notwendige Kooperation bei einem auf die Entscheidung über Hilfen in der Regelschule beschränkten Teilentzug der elterlichen Sorge leisten würde, ist nicht erkennbar. Insgesamt ließe sich damit die Kindeswohlgefährdung allein mit dem Entzug des Rechts der Antragstellung betreffend Jugendhilfemaßnahmen und nach den Sozialgesetzbüchern im Übrigen nicht in gleicher Weise abwehren wie mit dem Entzug des Rechts der Entscheidung in schulischen Angelegenheiten.
Auch mit dem vollständigen Entzug der Gesundheitssorge halten sich die angegriffenen Entscheidungen noch im die Eignung und die Erforderlichkeit betreffenden ‒ selbst bei engem ‒ Einschätzungsspielraum der Fachgerichte. Diese haben den Entzug der Gesundheitssorge mit der Erforderlichkeit ärztlicher Untersuchungen begründet und psychiatrische Untersuchungen lediglich als Beispiel angeführt. Insoweit legen die Beschwerdeführerinnen nicht dar, dass andere ärztliche Untersuchungen entgegen der Einschätzung der Fachgerichte nicht für die Entscheidungen in schulischen Angelegenheiten notwendig werden können.
Angesichts der festgestellten schwerwiegenden, vor allem aus dem Verhalten der Beschwerdeführerin zu 1) folgenden Beeinträchtigungen des Kindeswohls der Beschwerdeführerin zu 2) hat das Oberlandesgericht den Entzug von Teilen des Sorgerechts ohne Verstoß gegen Verfassungsrecht als angemessen bewertet.
(b) Die vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur schulrechtlichen Zuweisung eines Kindes auf eine damalige Sonderschule getroffenen Feststellungen (vgl. BVerfGE 96, 288 <296 ff.>) sind für die verfassungsrechtliche Prüfung der hier gegenständlichen Sorgerechtsentscheidung ohne Belang. Schon deshalb bedarf es einer Überprüfung dieser Maßstäbe anhand der zwischenzeitlich in Kraft getretenen UN-Behindertenrechtskonvention und neueren Erkenntnissen nicht. Die in der genannten Entscheidung aufgestellten Maßstäbe für eine schulrechtliche Zuweisung eines Kindes an eine Förderschule sind nicht mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen in einem kindesschutzrechtlichen Verfahren erfolgenden Entzug von Teilen der elterlichen Sorge identisch. Eine solche Maßnahme enthält nicht nur die Regelung eines schulischen Konflikts. Verfassungsrechtlich ist in der vorliegenden Konstellation nicht ‒ wie bei der schulrechtlichen Zuweisung ‒ der Konflikt zwischen der staatlichen Schulaufsicht nach Art. 7 Abs. 1 GG und der damit verbundenen Befugnis zur Organisation und Planung des Schulwesens auf der einen und dem Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und dem Persönlichkeitsrecht des Kindes aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie eventuell weiteren betroffenen Grundrechten auf der anderen Seite (vgl. BVerfGE 96, 288 <303 f.>) zu lösen. Vielmehr stehen sich in erster Linie einerseits das dem Schutz der Rechte des Kindes aus Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 GG dienende Wächteramt des Staates aus Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG sowie andererseits das Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG und das Recht des Kindes auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Zuwendung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gegenüber. Zur Prüfung einer Grundrechtsverletzung in einem solchen Fall sind daher die sich aus der angegriffenen Entscheidung ergebenden Einschränkungen für die Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten und gegebenenfalls weitere Nachteile mit den Vorteilen der Maßnahme, insbesondere den dadurch entstehenden Fördermöglichkeiten, sowie mit den Schutzbedürfnissen des Kindes umfassend abzuwägen. Diesen Anforderungen wird die Entscheidung des Oberlandesgerichts gerecht.
d) Damit verletzt der Beschluss des Oberlandesgerichts vom 13. Mai 2020 das Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) selbst dann nicht, wenn ‒ was keiner Entscheidung bedurfte ‒ wegen möglicher Wirkungen des Benachteiligungsverbots aus Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG der nicht mit einer Trennung von Eltern und Kind verbundene Sorgerechtsentzug nach strengen Maßstäben zu prüfen wäre.
2. Aus entsprechenden Gründen ist auch das Recht der Beschwerdeführerin zu 2) auf Gewährleistung elterlicher Pflege und Erziehung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG (vgl. BVerfGE 133, 59 <74 f. Rn. 43>; 151, 101 <123 Rn. 53>) ‒ selbst unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG ‒ nicht verletzt.
3. Von einer Begründung im Übrigen wird nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgesehen.
Diese Entscheidung ist unanfechtbar.
BVerfG, Beschluss vom 14.09.2021
1 BvR 1525/20